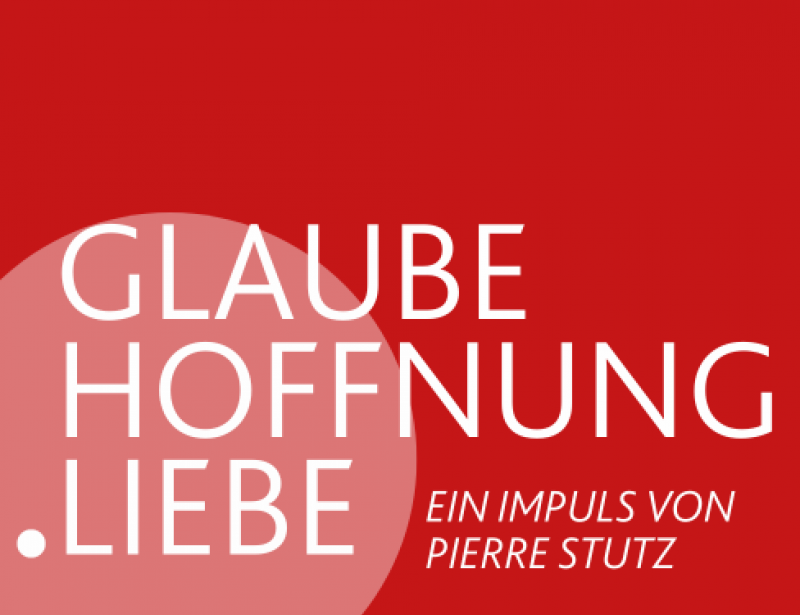Anfrage
Der Antwortpsalm in der Eucharistiefeier
Genauso wie es in Deutschland nicht überall üblich ist, in der Sonntagsmesse beide Lesungen vorzutragen, ist es mancherorts unüblich, nach der alttestamentlichen Lesung den Antwortpsalm zu beten oder zu singen. So wie offenbar bei Ihnen.
Warum gibt es den Psalm überhaupt? Eine Kernidee der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es, den Schatz, den die Bibel bietet, weiter zu öffnen; denn zuvor gab es nur eine geringe Auswahl an Lesungen, die sich jährlich wiederholten, und das Alte Testament war in der Leseordnung fast gar nicht vertreten. Seit der Reform hält das Lektionar für jeden Sonntag (außer in der Osterzeit) zusätzlich zum Evangelium eine Lesung aus dem Alten Testament und eine aus dem übrigen Neuen Testament bereit.
Die Liturgie hat einen Rhythmus aus Wort und Antwort: Im Wortgottesdienst hört die versammelte Gemeinde das Wort Gottes in der Bibel und antwortet darauf. Nach der ersten Lesung, also der aus dem Alten Testament, ist es nur folgerichtig, dass sie mit einem alttestamentlichen Gebet antwortet. Deshalb wurde zu jeder Lesung ein Psalm ausgesucht, der thematisch auf die gerade gehörte Lesung abgestimmt ist und sie vertieft. Das ist der erste Wert des Psalmgebets.
Der zweite ist, dass die Psalmen, die ein ganz grundlegender Gebetsschatz in der jüdisch-christlichen Tradition sind und die auch Jesus ganz zweifellos gebetet hat, bekannter werden. Viele Psalmen sind poetisch; sie loben und sie klagen, sie bitten und sie danken – und bieten damit Worte für unser eigenes Glaubensleben.
Drittens kann das Psalmgebet als Wechselgebet zwischen Vorbeter und Gemeinde ein besonderes Element im Gottesdienst sein. Im Idealfall singt ein Kantor oder eine Kantorin die Psalmen, die Gemeinde singt den Kehrvers. Zugegeben, das braucht eine gewisse Übung. Aber wenn eine Gemeinde es kann und will, wird sie diese ruhige, kontemplative Art vermutlich bald wertschätzen. Mehr als einen x-beliebigen Zwischengesang.