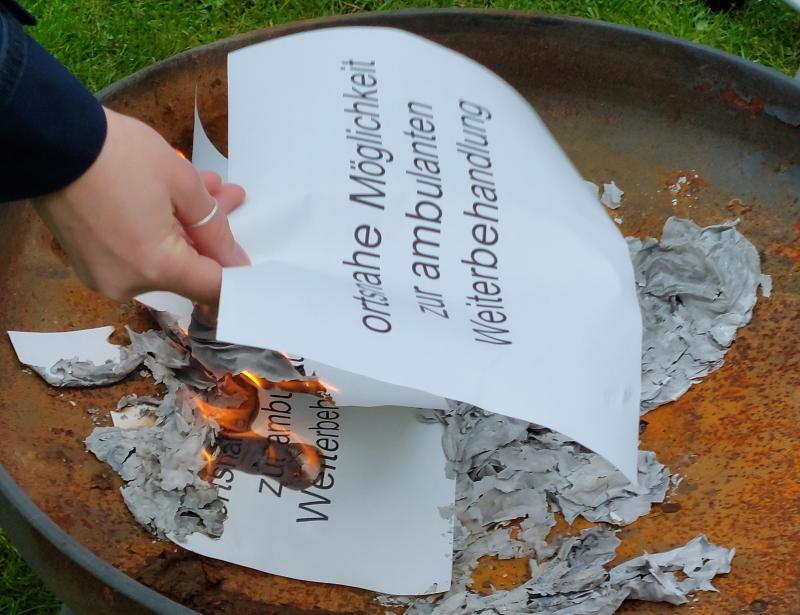Diese Puppe erzählt von Mitgefühl

Ein kleines deutsches Mädchen schreit sich die Seele aus dem Leib, weil die Mutter nach Sibirien deportiert werden soll. Eine polnische Frau schenkt ihr eine Puppe. Ein Zeichen der Menschlichkeit im Irrsinn der letzten Kriegsstage. Seitdem weiß Annelie Keil (81): „Immer gibt es jemanden, der dir die Hand reicht.“

Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten.
Das kleine Museum im Bahnhof Friedland bei Göttingen. Hier konzentriert sich ein Kapitel der Nachkriegs-Tragödie. Das Durchgangslager, Anlaufpunkt in chaotischen Zeiten für hunderttausende entwurzelter Menschen. Bilder, lange Listen mit den Namen von Vermissten, Zeitungsausschnitte. Dazwischen in einer Vitrine eine kleine Puppe aus Lumpen, zerzaust, abgegriffen, lädiert. Ein kleines Schild mit dem Hinweis: „Ein Püppchen zum Trost.“ Das Geschenk einer polnischen Frau für ein kleines deutsches Mädchen in einem Lager der sojwetischen Armee. Zufällig fällt mein Blick auf dieses Zeichen der Menschlichkeit aus einer Zeit, in der erst Vernichtung und dann Vertreibung das Leben bestimmt haben. Wer war dieses Mädchen? Und warum zeigt eine Polin Mitgefühl, die doch gerade Mord und Totschlag durch die Deutschen erlebt hat? Welche Geschichte verbirgt sich hinter dieser unscheinbaren Lumpenpuppe?
Das kleine Mädchen von damals lebt noch: Annelie Keil aus Bremen ist inzwischen 81. Natürlich würde sie diese Geschichte erzählen, immerhin habe sie ihr Leben geprägt, sagt sie am Telefon. Jetzt sitzt sie auf dem Sofa, umgeben von Andenken an ihre Reisen in alle Welt. Obwohl sie gesundheitlich angeschlagen ist („Ich habe mir wohl einen Nerv im Nacken eingeklemmt“), sind ihre Augen hellwach. Mit einfachen Worten berichtet sie von unfassbaren Dingen.
Am 6. Geburtstag auf die Flucht
Am 17. Januar 1939 kommt sie in Berlin als uneheliches Kind zur Welt. Die Mutter, eine überzeugte Sozialdemonkratin, ist mit der Situation überfordert und gibt die kleine Annelie in ein Kinderheim, das ein Jahr später in die besetzten Gebiete Polens umgesiedelt wird – nach Ciechocinek im „Reichsgau Wartheland“. Dort wächst das Mädchen auf. Sechs Jahre später, der Krieg ist verloren, die russische Armee auf dem Vormarsch Richtung Berlin, holt die Mutter sie ab, weil die Evakuierung des Heimes droht. Es ist der 17. Januar 1945, Annelies 6. Geburstag. „Sie hatte einen Kuchen für mich dabei und setzte mich auf einen Schlitten. Warum sie mich geholt hat? Mit einem Kind flieht es sich leichter, erzählte sie mir später.“
Dann das vergebliche Warten auf eine Zugfahrt, der Treck nach Westen. „Ich erlebe zum ersten Mal, was Krieg bedeutet. Sie schickten mich in die verlassenen Dörfer, um die Lage zu erkunden und Essbares zu organisieren. Ich sehe die ersten Toten am Straßenrand.“ Zwei Wochen zu Fuß durch den eisigen Winter, dann, bei Posen, in russisch-polnische Gefangenschaft.
Der russiche Offizier wird zum Freund
Zwei Erlebnisse aus dieser Zeit haben sich für immer in das Gedächtnis von Annelie Keil eingebrannt. Das eine: „Ein russischer Offizier erwischt mich, als ich Brot klaue. Er packt mich am Kragen und will mich bestrafen. Und plötzlich bricht er in Tränen aus, weil er in dieser Sekunde an seine Frau und seine drei Kinder denkt, die in Stalingrad ermordet worden sind.“ Der russische Offizier und das kleine deutsche Mädchen. „Er ist mein Beschützer, ich ersetze ihm seine Kinder. Er zeigt mir, wie man mit Granaten im zugefrorenen Wasser Fische fängt und fährt mit mir im Panzer durch die Gegend.“

vertrieben. Sie lebt in Bremen und war
dort Professorin für Sozial- und Gesund-
heitswissenschaften.
Für die Frauen des Lagers sind es harte Wochen. Immer wieder verschwinden sie für ein paar Tage im Keller. „Auch meine Mutter – obwohl sie sich ein paar Zähne ausgeschlagen hatte, damit sie älter aussieht …“
Das zweite Erlebnis: Die Frauen des Lagers werden in zwei Gruppen geteilt. Unter denen, die zur Zwangsarbeit nach Sibirien deportiert werden sollen, ist auch Annelies Mutter. „Ich sehe sie auf dem Lkw und schreie wie am Spieß, weil ich allein zurück bleiben soll. Ein Polin hat Mitleid mit mir. Sie geht ins Haus und kommt mit dieser kleinen Puppe zurück, drückt sie mir in die Hand und tröstet mich.“ Auch die Mutter darf wieder vom Lastwagen steigen: „Sie hatte im Gefängnis gesessen, verurteilt, weil sie Feindsender gehört hatte. Den Entlassungsschein hatte sie in der Manteltasche. Das bewahrt sie vor Sibirien.“
Weitere Wochen im Lager. Dann Richtung Westen. „Zum Abschied schenkt mir der russische Offizier eine Trillerpfeife. Wenn du in Gefahr bist, dann pfeifst du und ich werde dich retten, sagt er mir zum Abschied.“ Annelie Keil tauscht die Trillerpfeife gegen zwei Fahrkarten, der Zug bringt sie zunächst nach Berlin, dann nach Friedland. „Jetzt bist du zu Hause“, sagen sie dort. Zu Hause? Was soll das Mädchen damit anfangen? Es hat keine Kraft mehr. Ruhr und Typhus hinter sich, jetzt wird sie von Krätze gequält. Läuse am ganzen Körper. Eitrige Wunden auf dem Kopf, das Haar wird ihr abgeschnitten. Doch nach langer Zeit muss sie nicht mehr hungern, spielt mit anderen Kindern.
Annelie Keil hat überlebt, auch wenn Narben in der Seele geblieben sind. Sie hat gesehen, wie Menschen auf der Flucht erschossen und vergewaltig wurden. „Aber ich weiß auch, was die Deutschen an unsäglichen Verbrechen gegenüber den Polen und Russen begangen haben. In meinem Leben ist kein Platz für Schwarz-Weiß-Malerei.“
Die Puppe der Polin hat Annelie Keil ihr Leben lang begleitet: „Immer lag sie auf meinem Schreibtisch, sie erinnert mich an diese Zeichen der Menschlichkeit und des Mitgefühls. Und sie ist für mich ein Zeichen: Immer gibt es einen Menschen, der dir trotz allem die Hand reicht …“
Stefan Branahl