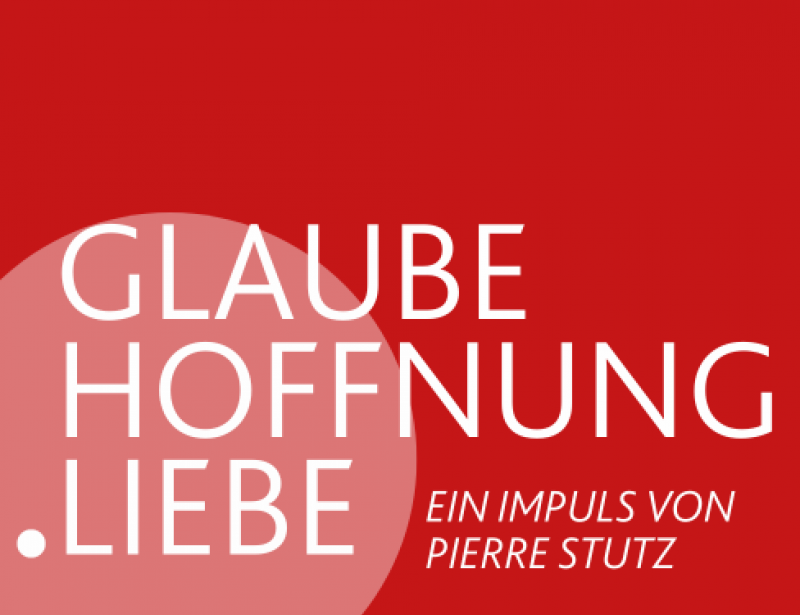Fastenzeit
Gründlich durch das eigene Leben kehren

Foto: istockphoto/voyagerix
Einmal auskehren und schauen: Wie kann ich als Christ mein Leben wieder neu ausrichten auf das, was wichtig ist?
Frau Schmitt, wozu ist Fasten eigentlich gut? Was bringt uns das?
Kurz vorweg: Wir nennen es Fastenzeit, aber eigentlich heißt es Österliche Bußzeit. Sie lädt uns Christen ein, uns mit Blick auf das Osterfest bewusst neu auszurichten – auf uns selbst, unsere Mitmenschen und Gott. Das kann gelingen, indem ich faste: auf Genussmittel verzichte und den Konsum insgesamt einschränke, aber auch das Gebet wieder mehr pflege oder besondere Gottesdienste besuche. Fasten fühlt sich für mich an, als würde ich mit einem Besen einmal gründlich durch mein Leben kehren, um zum Wesentlichen zurückzukommen. Reinigend, befreiend. Im Alltag schleichen sich ja doch immer wieder Gewohnheiten und Verhaltensweisen ein, bei denen ich mich frage, ob sie sinnvoll sind.
Zum Beispiel?
Wenn ich gestresst bin, greife ich gern zu Süßigkeiten. Das ist natürlich nicht sinnvoll (lacht). Ich könnte auch anders mit Stress umgehen: fünf Minuten frische Luft schnappen, mir ein Glas Wasser holen oder kurz die Augen schließen und danach weiterarbeiten. Dinge bewusst und mit Genuss tun – das macht Sinn und ist auch eine Erkenntnis in der Psychologie. Also: lieber ein Stück Schokolade richtig genießen, anstatt die Tafel auf einmal verputzen.
Muss Fasten wehtun?
Alles, was wir tun oder lassen, hat seinen Preis. Wenn ich mich auf die Österliche Bußzeit einlasse, kann das wehtun – aber im Sinne von: Ich verabschiede mich von liebgewonnenen Gewohnheiten. Es ist nicht der Sinn, dass es wehtut, sondern dass wir Freiraum gewinnen für Wesentliches, dass wir uns zum Beispiel Zeit nehmen, uns Gott und den Mitmenschen zuzuwenden und Beziehungen zu pflegen. Das Schöne an der Fastenzeit: Ich bekomme jedes Jahr eine neue Chance.
Viele wissen gar nicht, dass es früher noch mehr Fasten- beziehungsweise Bußzeiten gab.
Das stimmt. Vor der Liturgiereform durch das Zweite Vatikanische Konzil ähnelten sich die Oster- und die Weihnachtszeit. Es gab auch vor Weihnachten ein 40-tägiges Fasten, beginnend nach dem Sankt-Martin-Tag. Die orthodoxe Kirche kennt auch heute noch weitere Fastenzeiten.
Vor Weihnachten fasten – das würde für wenig Begeisterung sorgen, oder?
Das fände ich tatsächlich schwierig. Plätzchen und anderes Gebäck gehören zu den Adventstraditionen, auf die auch ich mich freue. Aber obwohl Fasten im Advent nicht mehr angesagt ist, gestalte ich diese Zeit ganz bewusst und esse zum Beispiel vorher keine Lebkuchen, obwohl es sie schon lange zu kaufen gibt.
Grundsätzlich ist für uns Christen auch jeder Freitag ein Fast- und Abstinenztag …
Genau. Wobei man unterscheiden muss: Fasten heißt, dass man am Fasttag nur ein Sättigungsmahl zu sich nimmt und sich morgens und abends mit einer kleinen Stärkung begnügt. Abstinenz bedeutet den Verzicht auf Fleisch. Dass man freitags kein Fleisch isst, als Erinnerung an das Sterben Jesu am Karfreitag, ist bei vielen Gläubigen noch präsent.
Wer gegen die mittelalterlichen Fastengebote verstieß, wurde hart bestraft. Heute geht es viel lockerer zu. Wie hat sich die Fastenzeit entwickelt?
Früher gab es sicher eine ganze Reihe Menschen, die sich vor allem an Fastenregeln gehalten haben, um Strafen zu vermeiden. Aber Fasten soll ja etwas bewirken, es hat mit mir und meinem Glaubensleben zu tun. Das macht Strafen völlig überflüssig. Außerdem: Wen würde das noch kümmern? Die Macht, Druck auf die Gläubigen ausüben zu können, hat die Kirche Gott sei Dank verloren. Heute gibt die Fastenordnung der Deutschen Bischofskonferenz Empfehlungen, etwa beim Essen zu reduzieren und den Konsum insgesamt zu überdenken. Dazu gehören heutzutage auch Klimafasten oder Handy-Abstinenz. Es ist immer besser, mit dem Sinn, der dahintersteckt, zu argumentieren.
Strikte Ernährungsformen wie Low Carb oder Intervallfasten sind allgemein sehr populär geworden. Woher kommt diese neue Lust am Verzicht?
Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Vielleicht hat sie mit einem Trend zu tun, den ich eher skeptisch betrachte: der Selbstoptimierung. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die uns antreibt, immer besser, immer schneller zu werden. Ich finde, es sollte darum gehen, einen Rhythmus zu finden, der uns gut leben lässt.
Was unterscheidet das christliche Fasten von der Selbstoptimierung?
Uns Christen geht es nicht nur um uns selbst, sondern auch darum, im Einklang zu sein mit der Welt, in der wir leben. Exerzitien nach Ignatius von Loyola beispielsweise verhelfen den Menschen zu einer inneren Freiheit, damit sie verantwortet wählen und entscheiden können. Insofern geht es auch im Christentum um Optimierung, aber immer mit dem realistischen Blick, dass wir nicht perfekt sind, keine Heiligen, keine Götter. Wir sind fehlbar, aber in den Augen Gottes sind wir dennoch geliebte Wesen. Dieser Zuspruch setzt Entwicklung frei. Es braucht Zeiten wie die Österliche Bußzeit, die uns daran erinnert: „Da ist mehr drin für dich!“
Andererseits: Unsere von Krisen geschüttelte Gesellschaft übt sich gefühlt im Dauerfasten. Die Lebenshaltungs- und Energiekosten steigen und auch das Bistum muss sparen. Da möchte man jetzt eher sagen: Gönnt euch mal was!
Verzicht ist oft negativ besetzt, er bedeutet eine Last für uns. Wir könnten das Wort auch mal ins Positive verkehren: Okay, ich habe zwar weniger Geld, aber brauche ich manche Sachen wirklich so dringend oder gönne ich mir lieber nur einmal im Monat etwas Gutes und zelebriere das so richtig? Ich möchte nichts schönreden, ich weiß, dass der harte Sparzwang im Bistum Osnabrück ganz schwierig werden wird. Aber wir könnten auch die Chance ergreifen und schauen, wo sinnvoll reduziert werden kann und woraus wir vielleicht sogar einen Mehrwert ziehen. Einfaches Beispiel: Wenn ich in der Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichte, könnte ich mir zu Ostern den Bauch vollschlagen. Oder ich stelle fest: Hey, so viel Zucker brauche ich in Zukunft gar nicht mehr.
Wie zeigt sich die Fastenzeit im kirchlichen Alltag?
Die liturgische Farbe der Österlichen Bußzeit ist Violett. Sie steht für Umkehr, Buße und Besinnung. Die Soldaten kleideten Jesus in einen purpurroten Mantel, um ihn zu verspotten. Purpur geht ins Violette über, deshalb erinnert die Farbe von Messgewändern und Altartüchern auch an die Passion Jesu. Hunger- oder Fastentücher, die zum Beispiel Triumphkreuze und Altarbilder verhüllen, ermöglichen ein Augenfasten. Wenn ich Dinge eine Zeitlang nicht sehe, kann ich sie wieder neu entdecken. Auch die Kirchenmusik in der Fastenzeit ist schlicht und hat nur unterstützenden Charakter. Danach kann Ostern, das Auferstehungsfest, umso mehr glänzen – mit der befreienden Zusage, das ewige Leben bei Gott zu haben.
Deutschland ist ein multireligiöses Land, es gibt neben der christlichen Fastenzeit den Ramadan und Jom Kippur als jüdischen Fastentag. Wie wichtig ist das Gefühl: Ich faste nicht allein?
Zeiten des Verzichts laden dazu ein, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Das kennen alle Religionen und das verbindet. Vielleicht ist Fasten sogar etwas Urmenschliches, etwas, das zu uns gehört und dem die Religionen einen Rahmen gegeben haben. Man denke nur an die ersten Menschen: Sie mussten manchmal fasten, im Winter oder wenn die Jagd nicht erfolgreich war, und konnten sich das nicht aussuchen. Wenn Exporte heute unsere Supermärkte nicht füllen würden, sähe unser Speiseplan grundsätzlich karger aus. Die Fastenzeit macht uns bewusst, dass es nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist, sich den Teller vollmachen zu können. Solidarität zu üben, daran erinnern zum Beispiel auch die Misereor-Fastenaktionen.
Es gibt dafür das alte religiöse Wort des Almosengebens. Findet sich das auch in anderen Religionen wieder?
Almosen für die Armen, das kennen alle drei monotheistischen Religionen, neben dem Christentum auch das Judentum, und es ist eine der fünf Säulen des Islam. Ein echtes Fastenopfer zu bringen, etwas herzugeben für Menschen, die Not leiden – das zeigt, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und füreinander Verantwortung tragen.
Worauf freuen Sie sich nach der Fastenzeit am meisten?
Allgemein freue ich mich darauf, dass mit Ostern der Frühling einzieht. Und: Ich feiere sehr gern Karfreitag, weil er so real ist. Jeder Mensch hat Karfreitag in seinem Leben. Das sollten wir nicht verdrängen, aber dann aus dieser Lebensrealität hineingehen in das Osterfest, das uns verheißt: Leben in Fülle, blühendes Leben, Auferstehung.