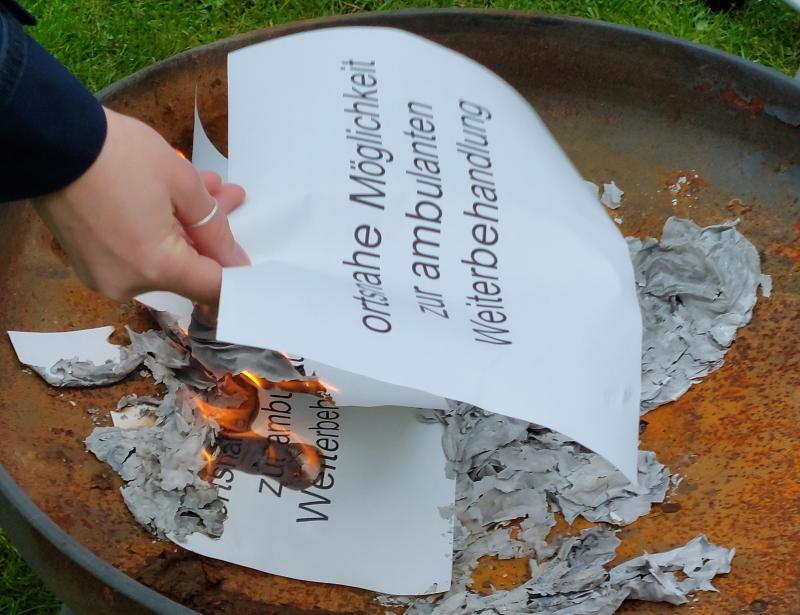Ort für Andacht und Besinnung
Hier finde ich meine Ruhe zum Gebet

Um in aller Hektik einen Ruheort für Andacht und Besinnung zu haben, richten sich manche Menschen einen „Herrgottswinkel“ süddeutscher Art ein. Andere finden einen Platz in der Nähe oder schaffen sich etwas ganz Eigenes. Tillo Nestmann hat Menschen besucht, die solche besonderen Orte für sich gefunden oder eingerichtet haben.

Herrgottswinkel. | Fotos: Nestmann
Ein Herrgottswinkel in Berenbostel
Ludwig Fiedler (81) und seine Frau Mechthild (76) haben in ihrem Wohnzimmer in Garbsen-Berenbostel einen Herrgottswinkel eingerichtet. Und der kann es durchaus mit einem bayerischen oder österreichischen Herrgottswinkel aufnehmen.
Der gebürtige Schlesier, der als Kind aus Neudorf (Kreis Breslau) vertrieben wurde, kannte so etwas von zu Hause nicht, genauso seine Frau Mechthild, die aus Hildesheim stammt. Beide sagen: „Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer der Eltern hing ein Kruzifix. Mehr war da nicht.“
Auf den Sinn eines Herrgottswinkels sind sie erst später und allmählich gekommen. Auslöser war ein Urlaub mit den Kindern auf einem kleinen Bauernhof im Jahr 1970 in Gsiestal, in Südtirol. Mit der Bauernfamilie beteten die Fiedlers jeden Abend gemeinsam den Rosenkranz — vor dem Herrgottswinkel. Ludwig Fiedler: „Wir wollten ja nicht als fromm gelten. Aber langsam wuchs in uns der Gedanke: Was wir lieben, soll auch in unserem Hause sichtbar sein.“
Alle Gegenstände im Herrgottswinkel haben eine Bedeutung. Das Kruzifix wurde von einer verstorbenen Tante geerbt. Die Madonna „Rosa Mystica“ haben sie von Josefa Trinczek gekauft, die früher viele Madonnen in die Sowjetunion geschmuggelt hatte, ein Stein stammt vom „Erscheinungsberg“ in Medjugorje, einem kirchlich umstrittenen Wallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina.
Wie oft versammeln sich die Fiedlers an ihrem Herrgottswinkel? „Mehrmals täglich, nämlich beim Tischgebet und beim Engel des Herrn, sagt Ludwig Fiedler. „Dann richten wir unseren Blick auf unseren Herrgottswinkel.“ Eine ganze Reihe von Besuchern ihres Hauses war nach Angaben von Ludwig Fiedler fasziniert. Ein paar haben inzwischen selbst einen Herrgottswinkel eingerichtet.

reichen Muttergottes.
Stille Andacht im Pfarrgarten
Im Garten der Kirche St. Franziskus in Hannover-Vahrenheide kniet Regina Golla (84) vor der Pietà und betet. Die Helligkeit draußen inmitten von Blumen bietet eine andere Atmosphäre als die Dunkelheit in der Kirche vor einer Nachbildung der Schwarzen Muttergottes von Tschenstochau. In den Marmor eingehauen stehen unterhalb von Jesus und Maria die Verse „Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand...“ (Gotteslob Nr. 594, 5. Strophe).
Regina Golla, die im Jahr 1976 aus dem oberschlesischen Andreashütte nach Deutschland kam, spricht die helle Umgebung sehr an. Die Pietà gibt es seit zwölf Jahren. Sie wurde aus der Platte des früheren Altars der Theresienkapelle in der St.-Fanziskus-Kirche gehauen. Etwas später kamen noch eine zu den Seiten hin offene Überdachung, Sitzbänke und eine Kniebank mit Polsterung hinzu.
Die Pietà wird von Einzelpersonen und kleinen Gruppen gern genutzt. Im Mai finden dort, wenn das Wetter mitspielt, Maiandachten statt. Trauernde lassen nach Beerdigungsfeiern den Sarg oft nicht gleich aus der Kirche in den Leichenwagen schieben. Sie schieben ihn einen kleinen Umweg von 50 Metern herum zur Pietà. Hier darf man, was in der Kirche verboten ist: vor dem Abschied den Sargdeckel noch einmal öffnen.
Oft wird die Pietà zusätzlich geschmückt. Zum Beispiel überlassen Trauergäste ihr nach dem Requiem den Blumenschmuck. Der kleine Engel am Fuß der Pietà ist ein Geschenk von Regina Gollas polnischer Nichte. Die beiden Laternen sind das Geschenk eines Zigeuners, der vor der Pietà kniend drei Tage für seinen sterbenden Vater gebetet hatte.
Regina Golla sagt: „Ich komme hierher aus Dankbarkeit. Meist vor den Werktagsmessen. Dann bin ich ungestört. Ich habe die schmerzhafte Muttergottes schon immer sehr verehrt. Viele Gebete hat sie erhört. Ich bin von ihr beschützt und bewahrt worden, habe vier Kinder, fünf Enkel und fünf Urenkel. Mein ganzes Leben ist in Gottes Hand gut verlaufen.“

aus der alten Heimat Bagdad. | Foto: Nestmann
Devotionalien und Terror
Mit Einsetzen der abendlichen Dämmerung werden in einem Hochhaus im hannoverschen Stadtviertel Sahlkamp drei Teelichter auf einem Leuchter entzündet. Sie brennen die ganze Nacht bis zum Morgen. Zusammen mit der Muttergottes in einer Muschel, aus Olivenholz geschnitzten Händen (original aus Betlehem) und einem Bild der Muttergottes bilden sie ein religiöses Stillleben auf dem Wohnzimmertisch der Familie Tobya. Mohanad Amanuel Tobya (51) und seine Frau Sahar Danial Butrus (47) sind Chaldäer, Katholiken des orientalischen Ritus, die bis heute Aramäisch, die Sprache Jesu sprechen.
Die Familie stammt aus Bagdad, hat drei erwachsene Kinder und lebt seit neun Jahren in Deutschland. „Morgens und abends beten wir gemeinsam das Vaterunser und das Ave Maria. Wenn wir das Haus verlassen, bekreuzigen wir uns. Zum Abend zünden wir die Lichter an, die bis zum Morgen brennen. Wir stellen uns damit ganz unter den Schutz des Heiligen Geistes.“
Jahrelang hat die Familie auf nichts anderes als den Heiligen Geist hoffen können. Mohanad Amanuel Tobya sagt: „Im Jahr 2004 wurde die 15 Meter von unserem Haus entfernte orthodoxe Kirche Santa Bechnam durch eine 600-Kilo-Autobombe in die Luft gesprengt. Trümmerstücke und Teile der Bombe sind zwei Kilometer weit geflogen. Wir hatten das Glück, dass der Explosionsdruck sich schräg nach oben bewegte und wir uns zum Auslöse-Zeitpunkt alle im Erdgeschoss befanden. In den oberen Geschossen wären wir alle tot gewesen. Es hat ja auch viele unserer Nachbarn erwischt. Und meiner Schwester Suhar wurde durch ein hochfliegendes Stahltor das Gesicht aufgerissen. Insgesamt wurde in Bagdad über ein Dutzend christlicher Kirchen in die Luft gesprengt. Niemand war auch nur einen Tag seines Lebens sicher.“
Während der eine Sohn Nano-Technologie, der andere Informatik studiert, studiert Tochter Maryam Amanuel (22) in Fulda Katholische Theologie. Wenn sie in den Semesterferien ihre Eltern in Hannover besucht, ministriert sie auch wieder in der Messe im Kirchort St. Franziskus.