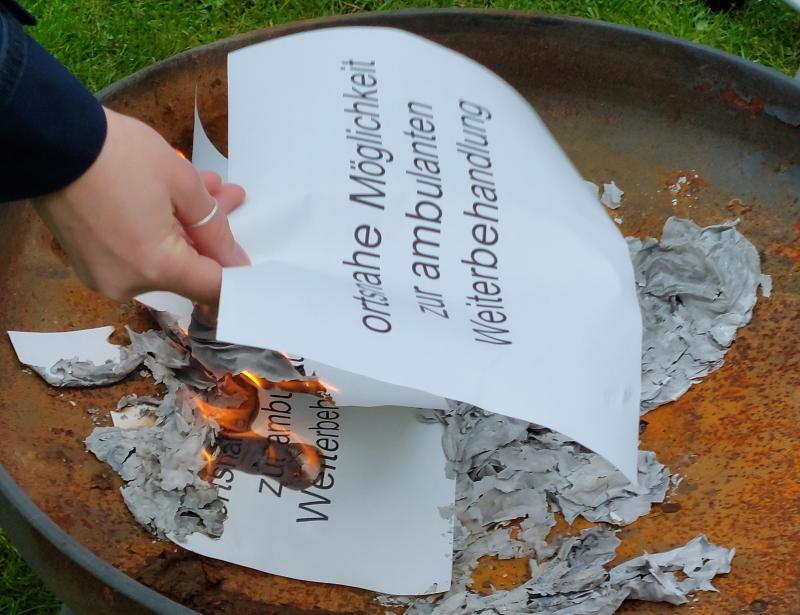Interview mit Michael Fürst
Toleranz nicht nur in eine Richtung

Michael Fürst ist Landesvorsitzender der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Im Interview mit der KiZ äußert er sich über Antisemitismus, das Verhältnis von Juden und Christen, zu einer speziellen Seite der Flüchtlingsproblematik und dazu, wie wichtig Zeitzeugen des Holocausts für die Jugend sind.

auch mit den Rechtspopulisten
auseinandersetzen.“ | Foto: Imago
Im kommenden Jahr ist es 75 Jahre her, dass das Nazi-Deutschland besiegt worden ist. Damit endete auch der Holocaust. Wie leben Juden ein dreiviertel Jahrhundert später in Niedersachsen?
Eigentlich sehr ruhig. Wenn man manche Äußerungen von jüdischen Funktionsträgern verfolgt, kann man leicht den Eindruck gewinnen, die Juden leben in ständiger Gefahr und werden bedroht, wenn sie auf die Straße gehen. Das sehe ich nicht so. Ich kann das Bild, das häufig in den Medien vermittelt wird, nicht bestätigen. Natürlich gibt es Antisemitismus in Deutschland wie auch in anderen Ländern. Die Zahlen, die die Landeskriminalämter und der Verfassungsschutz über antisemitische Vorfälle liefern, sind allerdings deutlich rückläufig. Was stimmt: In den letzten Jahren ist der Antisemitismus offener geworden und die Intensität hat zugenommen. Es geht nicht nur um verbale Attacken, sondern es kommt auch zu Handgreiflichkeiten. Aber im Prinzip können Juden in Deutschland sehr bequem wie jeder andere Staatsbürger auch leben.
In Berlin hat es im vergangenen Jahr einen Angriff auf einen Kippa tragenden jungen Mann gegeben. Kennen Sie ähnliche Vorfälle bei uns?
Nein, wir haben nach dem Vorfall in Berlin in Hannover gemeinsam mit dem NDR einen Versuch gemacht: Eines unserer Gemeindemitglieder hat sich an verschiedenen Orten von Hannover mit Kippa gezeigt und wurde von dem Fernsehsender mit einer verdeckten Kamera begleitet. Das Ergebnis: Er wurde überhaupt nicht beachtet, er wurde nicht angegriffen, nicht beschimpft, niemand hat ihm die Kippa vom Kopf gerissen, ihm ist nichts passiert. Genau das erwarte ich aber auch.
Der Bund hat seit 2018 einen Antisemitismusbeauftragen, die Stadt Hannover will eine Meldestelle gegen Antisemitismus einrichten. Brauchen wir so etwas? Löst das Probleme?
Es wird sicher kein Problem lösen. Ich habe Vorbehalte gegen solche Stellen, da es bereits eine Vielzahl von Institutionen gibt, die sich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigen. Daher wird mein Verband auf niedersächsischer Ebene eine solche Einrichtung auch nicht fordern, wir halten das zumindest nicht für zwingend erforderlich. Die neuen Zahlen des Innenministeriums zu antisemitischen Straftaten belegen diese Auffassung. Dies habe ich auch gegenüber Ministerpräsident Weil deutlich gemacht, der über die Einrichtung einer solchen Stelle nachdenkt. Aber wir sperren uns natürlich nicht dagegen, denn es gibt natürlich auch viele Gründe, die dafür sprechen. Dass nun Hannover mit einer eigenen Stelle vorprescht, halte ich für einen überzogenen Aktionismus. Die Landeshauptstadt sollte wenigstens die Entwicklung im Land abwarten, um dann gemeinsam zu sehen, was wirklich nötig ist.
Mit der Migrationswelle 2015 hat die Zahl der Muslime stark zugenommen. Spüren Sie aufgrund dieser Tatsache verstärkt Antisemitismus?
Nicht bei uns, andernorts wie in Berlin schon. Berlin ist schon lange ein arabisches Pflaster, und ich glaube, dass die Stadt die Antisemitismus-Problematik nicht so schnell in den Griff bekommt – wie andere Probleme ja ebenfalls nicht. Aber abgesehen davon müssen wir verstehen, dass wir seit 2015 einige hunderttausend Menschen mehr in Deutschland haben, die aus Ländern kommen, in denen der Jude als fremd und feindlich gesehen wird. Das haben diese Menschen mit der Muttermilch aufgesogen. Und ich kann nicht erwarten, dass sie dies sofort ablegen, wenn sie nun hier leben. Wir müssen daran arbeiten, dass sie ein Verständnis von unserer Demokratie und der gegenseitigen Achtung von Religionen bekommen. Wir müssen auch bedenken, dass diese Menschen ohne jegliche Erfahrung des Holocausts hierhergekommen sind. Das ist für sie ein Fremdwort. Da muss erstmal Grundwissen vermittelt werden. Aber wir können von jedem der als Flüchtling oder als Asylsuchender zu uns kommt, ein unbedingtes Anerkenntnis unserer Werte fordern und müssen dies auch durchsetzen. Toleranz ist keine Einbahnstraße.

Bischof Norbert Trelle als Geschenk zum 75. eine
kleine Torarolle. | Foto: Deppe
Wo liegen die Ursachen für den Antisemitismus?
Antisemitismus kann man weder in der Schule noch auf der Straße lernen. Das bringen Menschen von zu Hause mit. Diese Menschen mögen keine anderen. Sie mögen weder Juden noch Muslime. Sie hassen andere, sie sind fremdenfeindlich. Das ist eine Lebenseinstellung. Das lässt sich auch nicht bekämpfen wie wir selbst bei alten Menschen sehen, die den Holocaust noch miterlebt haben und sich dennoch antisemitisch äußern.
Es gibt immer wieder Kritik an der Politik Israels. Das darf man aber nicht mit Antisemitismus gleichsetzen, oder?
Das kommt ganz drauf an. Jeder hat das Recht, die Politik eines anderen Staates zu missbilligen. Auch mir missfällt vieles an der israelischen Politik. Aber dabei darf es nicht darum gehen, dem Staat Israel das Existenzrecht abzusprechen und ihn zu delegitimieren. Wir dürfen dabei nicht vergessen, woher dieser Staat kommt und dass diverse arabische Staaten ihn lieber heute als morgen vernichten würden.
Macht Ihnen das Erstarken rechtspopulistischer Parteien Sorge? Und ist die AfD eine antisemitische Partei?
Es macht mir keine Angst, wir müssen mit den Rechtspopulisten richtig umgehen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Nicht jeder AfD-Wähler ist ein Antisemit, und auch nicht jeder AfD-Abgeordnete. Aber die Partei muss sich Vorwürfe gefallen lassen, so lange sie Antisemiten wie Björn Höcke in ihren Reihen duldet. Zur Zeit ist die Partei für mich keine demokratiefähige Gruppe. Ich bin aber überzeugt, dass sich da langfristig etwas ändern wird.
Wie ist Ihr Verhältnis zu den christlichen Kirchen in Niedersachsen?
Sehr gut. Wir haben zwar im letzten Jahr mit der evangelischen Kirche die Auseinandersetzung um den Reformationstag gehabt, was ich den Protestanten bis heute übelnehme, aber das ändert nichts an den seit Jahrzehnten grundsätzlich guten Beziehungen zur evangelischen und katholischen Kirche in Niedersachen.
Und ihr Verhältnis zu den Muslimen? Haben Sie da verlässliche Ansprechpartner?
Das ist schwieriger, aber wir haben auch da vielfältige Kontakte. Wir haben einen sehr guten Draht zur palästinensischen Gemeinde Hannover mit ihren Vorsitzenden Yazid Shammout, mit dem ich über alles sprechen kann. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir hören einander zu und lassen dem anderen auch seine Sicht auf die Probleme. Das ist im Dialog der Religionen wichtig. Es gibt aber eine weitere palästinensische Gruppe in Hannover, die man zu den Israelfeinden rechnen muss. Das sind nicht unbedingt meine Gesprächspartner. Guten Kontakt haben wir auch zum neuen Verband „Muslime in Niedersachsen“, das sind sehr vernünftige Leute. Aber auch zur Ditib, und insbesondere zur Schura und dem Vorsitzenden Recep Bilgen bestehen ernsthafte Gesprächsfäden.
Die Landesregierung hat erklärt, weiterhin mit dem Moscheeverband Ditib zu kooperieren, andererseits hat die Justizministerin Barbara Havliza einen Vertrag mit der Ditib gekündigt, der die Gefängnisseelsorge durch muslimische Geistliche ermöglichte. Was erwarten Sie von der Politik?
Wir haben in Niedersachsen einige hunderttausend Muslime. Keine Partei und keine Regierung wäre gut beraten, wenn sie die komplett ausschließen würde. Erstens sind das Stimmen, zweitens aber auch Menschen, mit denen man zu tun hat. Und insofern kann ich nachvollziehen, dass die Landesregierung auch den Kontakt zur Ditib hält. Nach meiner Einschätzung ist der Regierung aber klar, dass es mit der Ditib, wie sie sich heute präsentiert, keinen Staatsvertrag geben kann. Frau Havliza geht vernünftigerweise einen Schritt weiter. Wenn Gefängnisseelsorger eine Sprache sprechen, die die Aufseher nicht verstehen, ist das auch ein Sicherheitsrisiko.
Die letzten Überlebenden des Holocaust sterben. Wie kann man das Gedenken sichern? Unternimmt die jüdische Gemeinde da etwas?
Wir verlieren einen wichtigen Pfeiler für die Bewusstseinmachung dieses Geschehens, insbesondere für junge Menschen. Zeitzeugen können Geschichte anders vermitteln als Bücher und Filme. Wir haben in Bergen-Belsen ein riesiges Filmarchiv mit sehr persönlichen Zeugnissen, aber es kann die persönliche Begegnung nicht vollständig ersetzen. Wir müssen die Geschichtsforschung und die Gedenkstättenarbeit neu gestalten. Darüber machen sich die Gedenkstättenleiter gerade Gedanken.
Marcel Reich-Ranicki hat angesichts des Holocaust gesagt, „Gott sei eine literarische Erfindung“. Kommen Sie mit einem Gott zurecht, der dieses Leid zugelassen hat?
Das ist keine Frage von Gott. An dem, was da passiert ist, ist nicht Gott schuld, sondern sind Menschen schuld. Wir dürfen Gott nicht die Verantwortung dafür auflasten.
Interview: Matthias Bode