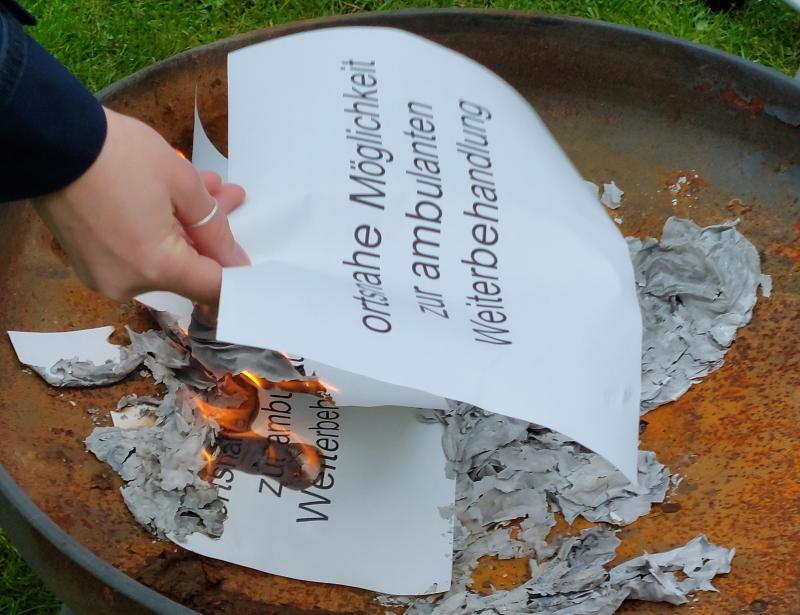Wie sieht das Leben auf der Staße aus?
„Immer durchhalten“

Angesichts der eisigen Kälte hat der Caritasverband Hannover sein Gebäude am Leibnizufer derzeit rund um die Uhr für Obdachlose geöffnet. Wie sieht das Leben auf der Straße eigentlich aus? Hanns-Joachim erzählt bei einem heißen Kaffee, was ihn bewegt.

zum Bild in den größeren Städten. | Foto: kna bild
Die Schlagzeile war zu erwarten, weil es kaum einen Winter gibt, in dem sie nicht in der Zeitung zumindest kurzfristig für Mitleid sorgt: In Hannover ist vor einigen Tagen ein Obdachloser nach einer Nacht im Freien an den Folgen von Unterkühlung gestorben. Ähnliche Meldungen werden folgen, solange das Thermometer eisige Temperaturen anzeigt. Menschen ohne eigene Wohnung, die zum Schutz vor der Kälte in den Eingängen der Geschäfte liegen, im Schalterraum der Sparkassen Schutz suchen oder eingemummt in den Schlafsack auf dem nackten Boden hocken, sind in den Städten allgegenwärtig.
Zahl der Obdachlosen hat sich verdreifacht
Ein Dilemma in einem der reichsten Länder der Welt. Rund 60 000 Obdachlose gibt es in Deutschland, sagt die Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das wären etwa dreimal so viel wie vor zehn Jahren. Zwar beruhen die Angaben auf Schätzungen, weil exakte Zahlen kaum zu ermitteln sind. Aber sie dokumentieren einen Trend: Weil Wohnraum immer teurer wird, landen immer mehr Menschen auf der Straße. Zumindest in großen Städten wie Hamburg, Berlin, Hannover gehört es zum Alltagsbild, dass sie ihre Habseligkeiten in Rucksack, Tüten oder Einkaufswagen transportieren. Das ist schlecht, denn Obdachlosigkeit hat Folgen: Menschen, die auf der Straße leben, werden oft krank, sind medizinisch nur schlecht versorgt, verwahrlosen, werden im schlimmsten Fall verprügelt oder sogar ermordet. Oder sterben still und leise in einer bitterkalten Nacht.
Hanns-Joachim möchte seinen Namen aus gutem Grund nicht vollständig veröffentlicht sehen. Seit 14 Jahren lebt er ohne festen Wohnsitz. Trotz der langen Zeit, in der jeder Kontakt zu Familie, Freunden und Bekannten abgebrochen ist, könnte ihn jemand identifizieren. Das wäre ihm peinlich, das möchte er nicht. Und darum auch die klare Ansage: „Junge, lass die Kamera stecken!“ Aber erzählen würde er, für einen Kaffee, wenn es geht.
Hanns-Joachim ist ein Kind des deutschen Wirtschaftswunders, Jahrgang 1956. Als Kind zog er mit den Eltern kurz nach Göttigen, dann ging es zurück nach Hannover. Maurer hat er nach der Schule gelernt, ein Job, der ihm Spaß gemacht hat. Dann kam die Konkurrenz aus den billigen Ländern, einige Jahre konnte sich der Betrieb noch über Wasser halten, schließlich ging der ganze Laden in Konkurs. „Wir waren fast 70, die entlassen wurden. Für mich war das der Anfang vom Ende“, erzählt Hanns-Joachim bei seinem im Sinn des Wortes nüchternen Rückblick. „Ne, ihr haltet uns ja alle für Alkis, aber das Zeug habe ich nie angefasst“, sagt er. Gut möglich. Das Gesicht hat tiefe Furchen, aber der Blick ist klar und die Worte sind präzise. Knapp ist die Schilderung des Abstiegs: Kein Geld für die Wohnung, ein paar Wochen Übergangsfrist bei Bekannten, dann die ersten Nächte draußen. Bis auf wenige Ausnahmen im Bunker, einer Übernachtungsmöglichkeit der Stadt, sind aus den paar Nächten im Freien mittlerweise tausende geworden. Routine bei Wind und Wetter. „Ich kenne jeden Schlupfwinkel, jedes Vordach, jedes Gebüsch zwischen Linden und Eilenriede.“
„Ein Kumpel stand ohne Schlafsack da“
Hanns-Joachim trinkt seinen Kaffee schwarz, aber mit viel Zucker. Wegen der Kalorien. Sein Tag hat heute schon früh begonnen. „Ich habe meine Klamotten in eine Plastiktüte gepackt und unter den Zweigen einer Fichte versteckt. Klauen lohnt sich nicht, aber trotzdem verrate ich nicht, wo ich im Moment schlafe. Ein Kumpel stand neulich plötzlich ohne Schlafsack da. Ganz schön beschissen ist das.“ Die Zeit wird lang, das Nichtstun, das Warten. Suppenküche, Tagestreff – da kann er sich aufwärmen. Aber meistens ist er allein mit sich und seinen Gedanken.
Natürlich ist Deutschland ein Sozialstaat. Und natürlich hat er die Pflicht, Menschen wie Hanns-Joachim unterzubringen. In den meisten Fällen gelingt das auch: Nur ein Teil der Menschen, die keine eigene Wohnung haben, lebt tatsächlich auf der Straße. Sechs Prozent, sagen manche, zehn Prozent schätzen andere. Und selbst denen sieht man es nicht unbedingt auf den ersten Blick an. „Junge, auch wir haben unseren Stolz. Die meisten jedenfalls. Nur manchmal denke ich, wenn du die ganze Zeit als Penner behandelt wirst, dann bist du irgendwann auch einer.“
Hanns-Joachim wird unruhig, er muss wieder raus. Hier im Imbiss drängeln sich die Menschen, das mag er nicht. Er hat sich in den Jahren daran gewöhnt, auf der Straße zu sein. Das ist auch ein bisschen Freiheit, sagt er. Manchmal, wenn er von einer eigenen Wohnung träumt, kommen ihm auch schnell wieder Zweifel, ob er die Enge überhaupt aushalten könnte. „Ich bin ein alter Hase und halte wohl noch ein paar Jahre durch. Aber für die Jungen, da müsste mehr getan werden.“ Er selbst hat gelernt, zurecht zu kommen. Sogar finanziell, auch wenn das Geld vom Sozialamt nur für die ersten Tage im Monat reicht. Viele würden ja nicht ahnen, wie teuer das Leben auf der Straße ist. Auf Vorrat kaufen? Im Sommer gammelt die Wurst in der Hitze, im Winter friert das Brot in der Plastiktüte.
„Hör mal, ich werde nicht rumjammern. Das ist nicht meine Art“, sagt Hanns-Joachim. „Ich hoffe, dass der liebe Gott mich nicht ganz aus den Augen verliert, immer durchhalten, das ist meine Devise.“
Stefan Branahl