Schwerpunkt: Umgang mit Schuld
Gott, warum lässt Du das zu?

Foto: privat
Nach Therapien und vielen Gesprächen blickt Heiko Bauder wieder positiv in die Zukunft.
1992 waren Sie 21 Jahre alt und als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr. Sie kamen von einer mehrtägigen Übung zurück zum Übungsplatz. Was ist dann passiert?
Ich war bei den Fernmeldern. In der Nacht mussten wir mit scharfer Munition das Lager im Wald bewachen. Am Morgen kam der Befehl zum Abmarsch und zur Manöverkritik am Truppenübungsplatz. Wir fuhren zurück und parkten unser Fahrzeug in der Kolonne am Wegesrand. Als einige der letzten kamen wir an, völlig übermüdet. Ich machte mich auf den Weg zum Truppenübungsplatz, da sehe ich aus dem Augenwinkel, dass an der Deichsel eines Lkw-Anhängers ein Gewehr steht.
Was haben Sie gemacht?
Wenn man als Soldat eine Waffe findet, muss man immer eine Funktionsüberprüfung machen, um zu schauen, ob noch Munition in der Waffe ist. Dafür zieht man den Ladehebel zurück. Dann kann man in den Lauf schauen und die Patrone entfernen. Ich habe das Gewehr auf dem Oberschenkel angesetzt, den Ladehebel durchgezogen, losgelassen, entsichert und abgedrückt. Und dann löste sich ein Schuss.
Warum haben Sie den Ladehebel losgelassen?
Ich weiß es nicht. Ich war völlig übermüdet. Aber ich wusste: Morgens um 7 Uhr musste die scharfe Munition von der Nachtübung wieder eingesammelt worden sein. Diese Patrone hätte nicht im Lauf sein dürfen.

Was haben Sie gedacht, als sich der Schuss löste?
Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich dachte: Scheiße, was jetzt wohl alles kommt. Eine falsche Funktionsüberprüfung ist bei der Bundeswehr ein richtiges Vergehen.
Im gleichen Moment stürzte ein Kamerad vor Ihnen zu Boden. Er war – von Ihnen unbemerkt – im Lkw gewesen. Konnten Sie einordnen, was da gerade passiert war?
Nein, überhaupt nicht. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht: Wo kommt er denn jetzt her? Was passiert hier? Und dann kam es mir schlagartig: Das war der Schuss!
Ihr Kamerad wurde von den Bundeswehr-Sanitätern notversorgt und in eine Klinik gebracht. Sie wurden in die Kaserne geführt.
Ja, ich wurde in einen Raum gebracht, abgesperrt und von einem Soldaten mit scharfer Munition bewacht.
Warum?
Niemand hatte den Unfall gesehen. Niemand wusste, was wirklich passiert war. Ich denke, die Leute dachten, es könnte sich um ein Tötungsdelikt handeln.
Wie haben Sie diese Zeit direkt nach dem Schuss erlebt?
Ich war komplett durch den Wind. In meinem Kopf war nur Chaos. Ich dachte: Was mache ich hier? Was ist da gerade eigentlich passiert? Aber auch: Was ist mit meinem Kameraden? Er hatte nicht geschrien, nur gewimmert. Kaum eine Regung gezeigt. Er ist aus dem Lkw gefallen wie ein schwerer Stein. Und ich habe gedacht: Nein, nein, was ist, wenn er stirbt? Ich bin schuld!
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie auch gebetet haben.
Ich habe geschrien: Gott, warum lässt du das zu? Und immer wieder Stoßgebete: Lass ihn nicht sterben! Lass das hier gut ausgehen! Es war ein Wechsel von völliger Verzweiflung hin zu völliger Wut. Wut darüber, dass so etwas passiert ist. Denn dieser Unfall war ja nie meine Absicht. Ich wollte doch nur die Bundeswehr hinter mich bringen, so wie alle anderen auch.
Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Kamerad an seinen schweren Verletzungen gestorben ist?
Ich war über eine Stunde alleine in dem Raum. Dann kamen Vorgesetzte, Offiziere und der Militärpfarrer. Ich habe es schon an ihren Gesichtern gesehen: Der Kamerad ist tot. Ich bin auf der Pritsche zusammengesackt und habe nur noch geheult.
Wie haben Sie die nächsten Stunden erlebt?
Ich wurde noch am gleichen Tag von der Kripo verhört. Dabei stand ich völlig unter Schock. Es war eine Tortur. Zugleich war es mir aber auch wichtig, jemandem zu erklären, dass das ein Unfall war: Ich habe das nicht gewollt. Es tut mir so leid! Am Abend hat der Militärpfarrer mich zu sich und seiner Mutter genommen. Bei ihm konnte ich die nächsten Wochen wohnen.
Wie waren diese Wochen?
Ich wollte von niemandem etwas wissen. Ich wäre bereit gewesen zu sterben. Ich habe gedacht: Wenn ich jetzt sterben könnte und mein Kamerad kann dafür wieder leben – ich würde sofort zustimmen. Alles andere hat mich nicht interessiert. Ich wollte niemanden sprechen, nicht essen. Das war mir alles egal. Ich saß einfach nur da und habe mich gefragt: Warum er – und nicht ich?

Sie fühlten sich schuldig?
Ja, klar. Ich war derjenige, der den Abzug gedrückt hatte. Ich habe einen Fehler gemacht, den man bei der Bundeswehr nicht machen darf. Das war mein Teil der Schuld, dass er ums Leben gekommen ist. Für mich war der Unfall wie ein Film, der nonstop in mir abgelaufen ist. Immer wieder habe ich überlegt: Was hätte ich anders machen können, damit das nicht passiert wäre? Ich habe die Situation immer wieder durchdacht.
Gelang es Ihnen, diesen Film zu stoppen?
Nein, nicht wirklich. Die erste Person, die an mich herankam, war die Mutter des Pfarrers. Die sagte im besten Bayerisch zu mir: „Komm jetzt rein, hock di hie und iss was! Dann geht’s dia gleich a bisserl besser.“ Sie hatte so eine liebevolle Art. Sie war wie ein Engel für mich. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht: Wie kommen diese Leute dazu, mich bei ihnen wohnen zu lassen? Wissen die überhaupt, was ich getan habe? Warum sind die so nett zu mir? Aber es tat gut. Das war ein erster Schritt raus – nicht aus dem Film, aber doch ein Auftauchen, eine Rückkehr ins Leben.
Wie hat der Pfarrer Ihnen in dieser Zeit geholfen?
Am Anfang hat er mir meine Ruhe gelassen. Beim Essen hat er mich manchmal gefragt: „Wie geht es dir? Was denkst du gerade?“
Haben Sie mit ihm über Ihre Schuldgefühle gesprochen?
Nein, nicht direkt. Er hat das so stehengelassen. Aber er hat mein Selbstwertgefühl langsam aufgebaut. Ich wollte ihm damals etwas für die Kost und Logis zahlen. Aber er lehnte Geld ab. Er meinte, der Rasen müsste mal wieder gemäht werden. Das habe ich dann getan. Und ich spürte: Ich war zu etwas nützlich und zu gebrauchen.
Haben Sie mit ihm über das Gedankenkarussell gesprochen?
Ja, er sagte mir, ich könnte den Film stoppen. Aber dafür müsste ich alles noch einmal durchleben. Ich musste mir bewusstwerden, dass das die Realität ist – und eben kein Film.
Der Pfarrer entwickelte einen Vier-Punkte-Plan für Sie. Unter anderem sollten Sie die Schauplätze des Unfalls noch einmal besuchen. Was haben Sie davon gehalten?
Gar nichts. Ich habe gesagt: Nein, ohne mich. Ich wusste, was mich da erwartete. Allein der Gedanke, dahinzugehen, war eine absolute Katastrophe.
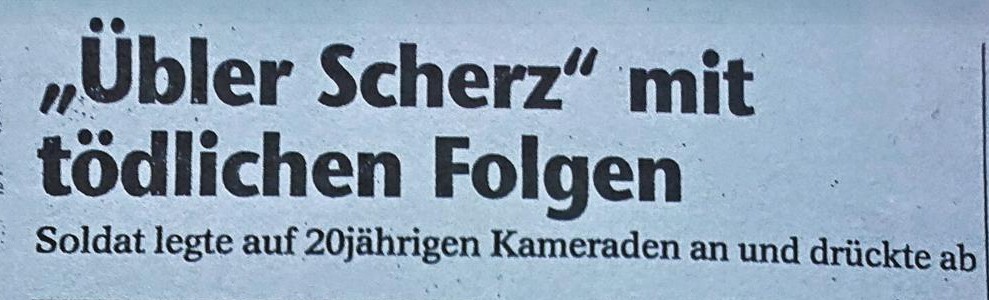
Und trotzdem sind Sie mit ihm zum Übungsplatz gefahren.
Da war nichts mehr. Kein Lkw, kein Blut, nur diese Straße. Und trotzdem war die Szenerie für mich komplett real. Bei einem zweiten Termin sind wir zur Kaserne und haben uns den Lkw angeschaut. Ich bin jedes Mal zusammengebrochen. Ich merkte aber auch: Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, mein Leben muss weitergehen. Ich konnte die Situation ein Stück weit besser annehmen. Und mit jeder Station kam ich etwas mehr aus dem Film heraus.
Sie sind auch zum Grab Ihres Kameraden gefahren.
Auf der einen Seite wollte ich das. Ich wollte eine Begegnung und Abschied nehmen. Wir hatten uns gekannt und wertgeschätzt. Und ich wollte ihm am Grab sagen, wie leid mir das alles tut.
Und auf der anderen Seite?
Je näher wir dem Friedhof kamen, desto größer wurde mein Fluchtgedanke. Ich habe schon von weitem das Grab gesehen: alles frisch, voller Blumen. Jeder Schritt war wie Blei. Vor dem Grab konnte ich nur noch stammeln und dann war es vorbei. Ich habe nur noch geweint. Trotzdem habe ich gemerkt: Es war gut. Ich hatte das Gefühl, das, was ich ihm sagen wollte, war raus. Es ist bei ihm angekommen.
Die letzte Station war ein Gespräch mit den Eltern Ihres toten Kameraden. Wie schwierig war das für Sie?
Das kann man nicht in Worte fassen. Das wünsche ich nicht meinem größten Feind. Es war grausam – für mich und für die Eltern. Ich bin da mit dem Vorsatz hin, so vom Unfall zu berichten, wie ich es erlebt hatte. Ich hatte die Hoffnung, dass sie es verstehen und im besten Fall sagen: Es ist grausam, aber du kannst auch nichts dafür.
Wie haben die Eltern reagiert?
Die Mutter hat nur geweint. Und der Vater sagte: Das ist also der, der meinen Sohn auf dem Gewissen hat.
Was hat dieser Satz mit Ihnen gemacht?
Das ging ganz tief rein. Daran habe ich lange geknabbert, über Jahre. Nach dem Gespräch habe ich gesagt: Ich möchte nie wieder erleben, an etwas schuldig zu sein.
Ist der Plan des Pfarrers letztlich trotzdem aufgegangen?
Ja. Ich musste mich der Situation stellen und jeder Schritt in seinem Plan war auch ein Schritt in die Freiheit. Ich konnte immer ein Stück des Unfalls hinter mir lassen. Und ich habe etwas geleistet: Ich konnte vor dem Spiegel stehen und sagen, dass ich mich dieser Konfrontation nicht entzogen habe.
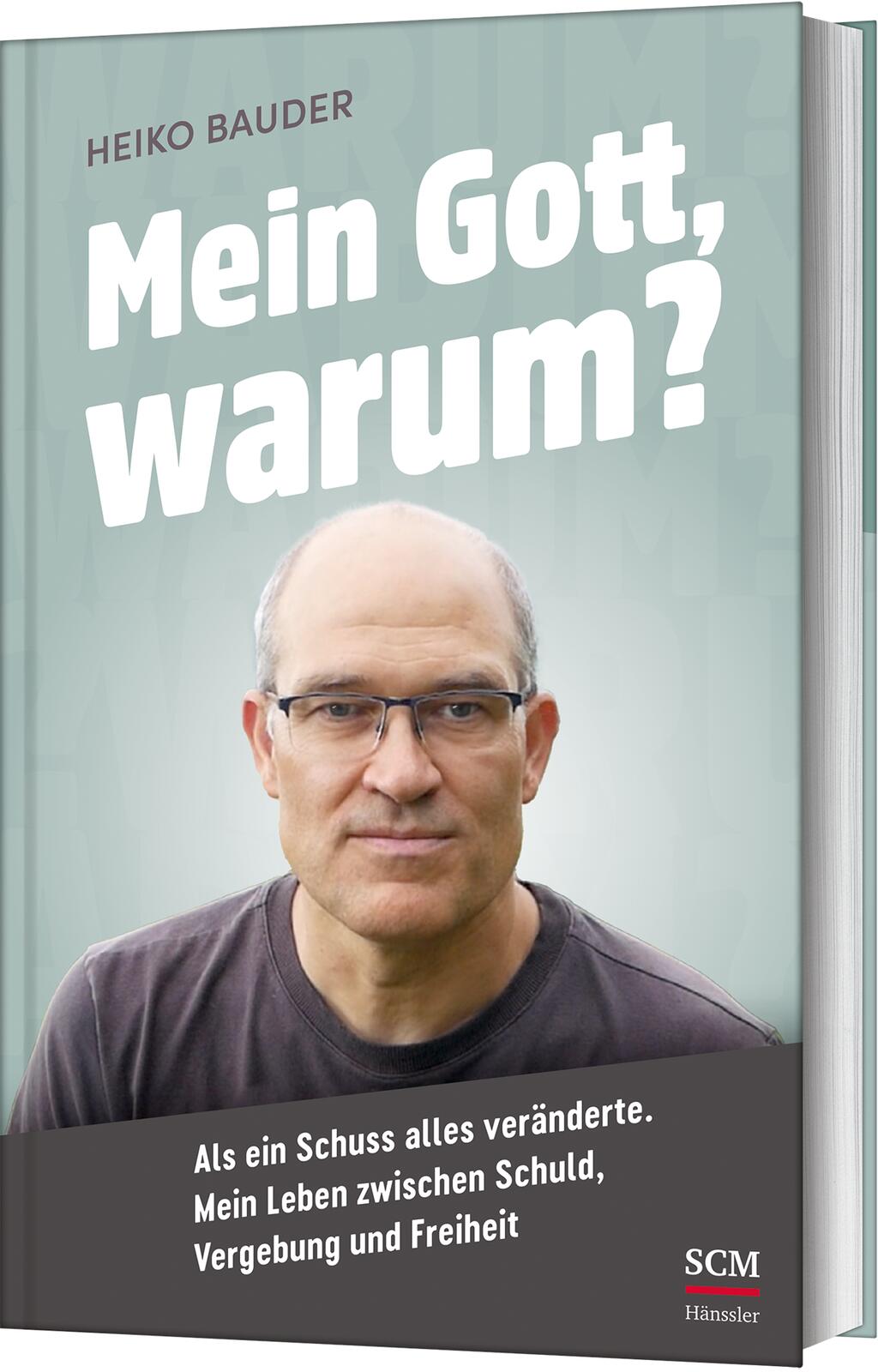
Hat es auch geholfen, die Frage nach dem Warum, die Ihnen ständig im Kopf herumgeisterte, loszulassen?
Ein wenig. Sie ist bis heute präsent. Ich habe aber gelernt, eine neue Haltung einzunehmen. Die Frage richtet meinen Blick immer nach hinten. Ich kann aber an dem, was passiert ist, nichts mehr ändern. Heute habe ich meinen Frieden mit der Frage gemacht und überlege eher: Wozu ist das alles passiert? Was kann ich daraus lernen?
Und?
Durch den Unfall bin ich dem Pfarrer begegnet und konnte erleben, wie er mir, aber auch vielen anderen Soldaten geholfen hat. Ich habe gesehen, wie er mit Menschen umgeht, wie er sie aufrichtet, wenn sie am Boden sind. Da habe ich gemerkt: Das möchte ich auch können. Und Jahre später, als ich wieder gefestigter war, habe ich begonnen, mich stark in der Jugendarbeit zu engagieren, Freizeiten anzubieten. Es machte mir Spaß, die jungen Menschen zu begleiten. Da habe ich ein Stückweit das Erbe des Pfarrers fortgeführt.
Eine weitere intensive Phase für Sie war der Gerichtsprozess. Wie haben Sie ihn empfunden?
Ich hatte eine riesige Angst. Was kommt da? Was wollen die Leute wissen? Wie werde ich behandelt? Die Eltern waren als Nebenkläger da. Viele Zeugen waren geladen. Und ich hatte das Gefühl, auf meiner Seite steht keiner.
Sie haben vor Gericht – gegen den Rat Ihres Anwalts – vollumfänglich ausgesagt. Warum?
Er meinte, ich sollte sagen, ich hätte unter Schock gestanden und könnte mich nicht mehr richtig an den Ablauf des Unfalls erinnern. Das wäre strafmildernd gewesen. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte es genau so sagen, wie ich es dem Pfarrer und den Eltern erzählt habe.
Warum war das wichtig für Sie?
Weil es einfach so war: Ich war schuld! Ich habe den Abzug gedrückt. Ich könnte nicht damit leben, wenn ich nicht die ganze Wahrheit gesagt hätte und dafür freigesprochen worden wäre. Alles in mir hat sich dagegen gewehrt.
Sie sind wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie hatten Ihre Schuld nun Schwarz auf Weiß.
Und die Strafe wurde im Namen des Volkes gesprochen. Diese Floskel gehört natürlich dazu. Aber für mich war das so: Das ganze Volk sagt, du bist schuld. Alle empfinden so und stimmen dem Gericht zu. Das hat mich getroffen.
Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass Sie sich nach dem Urteil frei gefühlt haben. Inwiefern?
Zum einen, weil es vorbei war. Das Urteil war rein formal ein Abschluss für mich. Zum anderen, weil ich mir in dieser Verhandlung treu geblieben bin. Ich habe nicht das getan, was einer geringeren Strafe zuträglich gewesen wäre, sondern habe auf mein Wahrheitsempfinden gehört. So bin ich zwar verurteilt und vorbestraft, aber innerlich frei aus dem Gerichtssaal gegangen.
Ich könnte nicht damit leben, wenn ich nicht die ganze Wahrheit gesagt hätte.
Sie sind gläubiger Christ. Wie hat der Unfall Ihr Gottesbild verändert?
Kurz nach dem Unfall habe ich mich immer wieder gefragt: Gott, wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich wollte meinen Glauben abhaken und laut sagen: Lass mich in Ruhe, hau ab!
Aber?
Es ging nicht. Ich brachte das nicht über die Lippen. Und das machte mich noch wütender auf mich selbst und auf Gott. Aber ich lernte in dieser Zeit, dass ich Gott auch anklagen darf. Dass ich mit ihm streiten kann. Das war neu für mich – und wohltuend. Und wenn ich heute auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, dann sehe ich, wie Gott mich und meine Familie durch tiefe Täler geführt hat. Er hat nichts verhindert – aber er war immer bei uns.
Wann haben Sie begonnen, sich die Schuld am Unfall zu vergeben?
Ich habe jahrelang mit einer Maske gelebt: Ich war dabei, wenn meine Freunde sich getroffen haben. Aber ich habe mir keine Freude und keinen Spaß im Herzen erlaubt. Und dann war da dieser eine Abend bei einem Jugendtreff. Jemand erzählte etwas und ich musste richtig herzhaft lachen. Das war das erste Mal, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, ob mein Lachen okay oder angebracht ist. Und ich merkte, dass niemand mich schräg anschaut. Dass niemand sich fragt: Wie kann er nur lachen, bei dem, was er getan hat?
Wie schwierig war es, sich selbst die Schuld zu vergeben?
Eines der schwierigsten Dinge in meinem Leben. Tatsächlich war mir mein Glaube dabei eine Hilfe: Wenn ich wirklich an Gott glaube und daran, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld, wie er in der Bibel sagt, dann ist diese Schuld getilgt. Wenn Jesus mir vergibt, dann muss ich mich nicht mehr selbst ans Kreuz nageln. Das hat mir einen großen Trost gegeben.
Gab es noch einen Moment der Vergebung?
Viele Jahre später hatte ich ein Bewerbungsgespräch in einem Unternehmen, in dem tatsächlich die Mutter meines toten Kameraden arbeitete. Der Personalchef sagte mir, wenn du hier anfangen willst, dann musst du mit der Mutter reden.
Wie war das?
Wir haben miteinander gesprochen und geweint. Sie hat sinngemäß gesagt: Ich weiß, du trägst nicht die Schuld allein. Es gibt viele Seiten, die schuldig geworden sind. Da ist ein Zentner von mir abgefallen. Diese Schuld war wie ein Schatten, der immer mit mir ging, den ich nicht abschütteln konnte. Und auf einmal war er weg. Diese Vergebung zugesprochen zu bekommen, war eine ganz andere Qualität.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, wie sehr der Staatsanwalt Sie vor Gericht mit seinen Aussagen getroffen hat. Sie beschreiben, wie er all die Jahre noch in Ihrem Kopf herumspukte und Ihr Denken und Handeln beeinflusste. Konnten Sie auch ihm vergeben?
Ganz lange nicht. Er hat mich im Gerichtsprozess als minderbemittelten Jüngling dargestellt, der mit einer Waffe herumgespielt hatte und an dem ein Exempel statuiert werden müsste. Das hat sich bei mir eingebrannt. Erst mit Hilfe einer Therapie konnte ich auch diese Gedanken loswerden. Da bin ich ihm in meinem inneren Raum der Gefühle begegnet und habe ihn angeschrien, damit er endlich auch kapiert, wie der Unfall wirklich abgelaufen ist. Dass ich nicht mit Absicht gehandelt habe.
Ein wichtiger Moment für Sie?
Absolut. Das war der letzte Mosaikstein, um die Sache abzuschließen. Und auch zu vergeben. Ich finde es bis heute nicht gut, wie er mich vor Gericht behandelt hat, aber ich habe mal gelesen: Sind wir bereit, denen zu vergeben, die uns verletzt haben? Können wir die Menschen an Gott und seine Gerechtigkeit übergeben? Seit dieser Therapiestunde kann ich das. Ich konnte loslassen.
Sie haben in den Jahren nach dem Unfall in Ihrer Familie noch viele Schicksalsschläge überwinden müssen: eine schwere Erkrankung Ihrer Frau, gravierende Brandverletzungen bei Ihrem Sohn, ein schwerer Autounfall mit zwei Ihrer Kinder. Fühlen Sie sich nach all dem heute gewappneter?
Nein. Es wäre anmaßend zu glauben, ein weiterer Schlag könnte mich nicht mehr umhauen. Aber ich weiß, was Gott versprochen hat: Er geht mit uns. Daran möchte ich mich festhalten
Zur Person:
Heiko Bauder (geboren 1971) lebt in der Gemeinde Kohlberg am Fuße der Schwäbischen Alb. Er arbeitet als Ausbilder für angehende Industriemechaniker und engagiert sich in seiner evangelischen Kirchengemeinde stark in der Jugendarbeit. So bieten er und seine Frau etwa Freizeiten während des Konfirmandenunterrichts an. Bauder hat sich daher auch zum Erlebnispädagogen und Personal Coach ausbilden lassen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.



