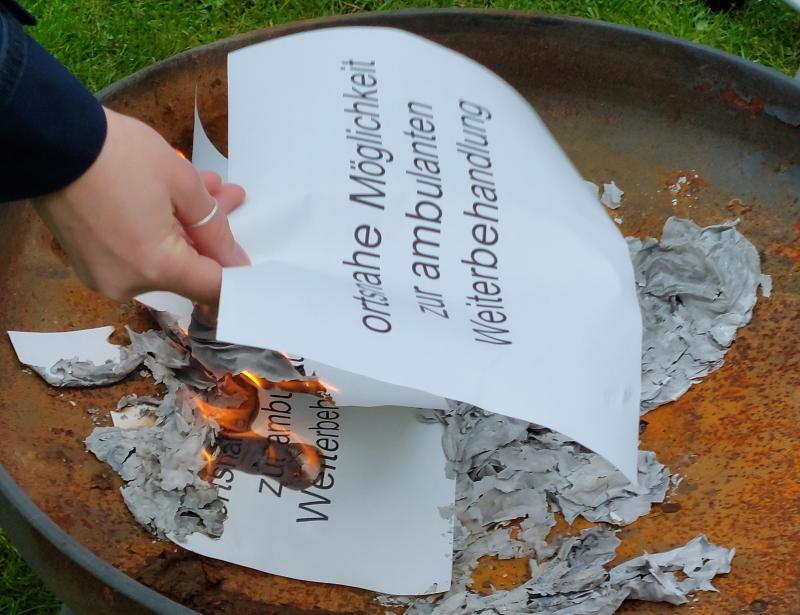Navigation für die Seele
Die katholische Seemannsmission Stella Maris bietet im Hamburger Hafen den Schiffsbesatzungen nicht nur praktische Hilfe. Gleichermaßen bietet sie auch Möglichkeiten für Gespräche, Gebete und Gottesdienstbesuche.
VON MATTHIAS SCHATZ
„Wer ist denn das?“, fragt der stämmige Mann im grellen orangefarbenen Overall in gebrochenem Englisch und mit leicht finsterer Miene. „Stella Maris, katholische Seemannsmission“, gibt einer der drei Filipinos zurück, die im fahlen Neonlicht der Mensa gerade ihr Mittagessen eingenommen haben. Augenblicklich löst sich seine skeptische Miene in ein freundliches Lächeln auf. „Ah, Stella Maris, good“, sagt er und setzt sich auf einen der mit blauem Kunstleder gepolsterten Stühle. Er interessiert sich weniger für die Flyer mit Anlaufadressen, über die die Seeleute beispielsweise Bestellungen an Land aufgeben können, oder die Süßigkeiten, die Lejla Semsi von Stella Maris mit an Bord gebracht hat und für die die Filipinos großes Interesse zeigen. Er will einfach nur reden. Und Lejla Semsi hört einfach nur zu.
Er komme aus Mykolajiw, berichtet er. Die Hafenstadt liegt zwischen Odessa und Cherson im Süden der Ukraine und ist gleich nach Beginn des Krieges zur Frontstadt geworden. Als er auf See gewesen sei, sei seine Frau bei einem Raketenangriff der Russen ums Leben gekommen. Ein Freund habe sich seiner beiden Kinder angenommen, sie auf abenteuerlichem Weg schließlich in die Türkei gebracht. Zwischenzeitlich habe er sie mehrmals besucht, musste sie dann aber wieder verlassen, um auf einem Schiff Geld zu verdienen. „Warum dieser Krieg?“, seufzt er wiederholt. Dann krächzt eine Stimme aus seinem Walkie-Talkie, er wird an einer anderen Stelle des Kalifrachters gebraucht.
Lejla Semsi hat in den vergangenen Monaten schon einige Leidensgeschichten ukrainischer Seeleute gehört, aber diese zählt zu den erschütterndsten. „Viele Ukrainer, die auf See sind, kämpfen mit sich, ob sie in ihre Heimat zurückgehen, wo sie dann bleiben und möglicherweise in den Krieg ziehen müssen. Wenn sie in einem anderen Land bleiben, besteht die Chance, auf einem anderen Schiff anzuheuern“, berichtet Monica Döring, die den Hamburger Stützpunkt von Stella Maris seit 2017 leitet.
Unterstützung durch weltweites Netz
Gleichwohl gibt es Ausnahmen, in denen Stella Maris helfen konnte. So arrangierte es die katholische Seemannsmission, dass ein ukrainischer Kapitän von seiner Familie in Hamburg besucht werden konnte. Ihr kam überdies das weltweite Netz von Stella Maris zugute. Durch den Kontakt zum Stützpunkt im Vereinigten Königreich hatte die Familie zuvor eine sichere Unterkunft bei Stella Maris im polnischen Gdynia gefunden.
Im Schnitt besuchen Döring und Semsi pro Tag jeweils vier Schiffe. Ihre Tätigkeit sowie die der sechs Ehrenamtlichen gilt rechtlich als „aufsuchende Sozialarbeit“. Das bedeutet, sie müssen sich nicht vorher anmelden, wenn sie ein Schiff besuchen wollen. „Die Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Zeitpunkt zu finden“, erklärt Semsi auf der Fahrt im weitläufigen Hafengelände vom Sitz der Seemannsmission am Ellerholzweg zum Kalikai mit einem der beiden Kleinbusse von Stella Maris. „Wir unterbrechen natürlich den Arbeitsablauf an Bord.“ Günstig sei die Mittagszeit, in der die Seeleute meist ohnehin nicht arbeiteten, sondern etwas äßen und sich unterhielten.
Jeden Morgen wird ein Corona- Schnelltest gemacht, denn Semsi und Döring wollen natürlich keine Krankheiten an Bord schleppen. Die Pandemie ist auch einer der Gründe, warum viele Seeleute immer noch nicht an Land gehen dürfen. „Offiziell darf ein Landgang aber hier in Hamburg nicht verboten werden“, sagt Monica Döring. Nach einer Umfrage, die die evangelische Seemannsmission Duckdalben vor drei Monaten durchgeführt habe, blieben aber etwas mehr als die Hälfte der Seeleute an Bord. Döring: „Teilweise sind die also bis zu elf Monate auf See.“
Da ist Abwechslung willkommen. Und praktische Hilfe notwendig. Gerade zu Beginn der Coronapandemie waren beispielsweise SIM-Karten überaus gefragt, die die Seeleute brauchten, um mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Die Karten konnten aber nur an Land erworben werden, also brachten sie die Seemannsmissionen auf die Schiffe. Auch skurrile Wünsche waren dabei. So wollte ein Seemann beispielsweise Blumenerde haben, weil er an Bord Tomaten züchtete.
Themen sind der Glaube und was im Leben zählt
Begehrt sind ebenso Adressen für Treffpunkte an Land. Einen bietet Stella Maris in dem Schleusenwärterhaus, das die katholische Seemannsmission vor rund acht Jahren bezogen hat. Allerdings nur in bescheidenem Maße. Es gibt dort neben den Büros Rückzugräume: ein Fernsehzimmer, in dem auch eine Gitarre bereitsteht, einen Besprechungsraum und eine kleine Kapelle zum Beten.
Solche praktischen Hilfen sind aber nur ein Teil der Arbeit. Dies zeigt besonders eindringlich der Besuch auf dem Kalifrachter. Die Seelsorge ist mindestens ebenso wichtig. „Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz“, erklärt Döring. „Wir sind auch Türöffner zur Kirche.“ Was die Politik in den Heimatländern der Seeleute angehe, halte man sich zurück. Auch über die Religionszugehörigkeit werde nicht gesprochen. „Allgemein reden wir aber schon über den Glauben und darüber, was im Leben wichtig ist, was Kraft gibt.“
Wenn es willkommen sei, folge zum Abschluss auch ein Gebet, berichtet Döring. Auf Nachfrage kann auch kurzfristig ein Gottesdienst an Bord mit Pater Ritchille Salinas arrangiert werden. Er stammt wie viele Seeleute von den Philippinen, wo die weit überwiegende Zahl der Bewohner katholisch ist. Jeden Sonntag wird zudem eine Pendelfahrt zur Messe der philippinisch-katholischen Mission im Kleinen Michel angeboten. Zu Weihnachten und Ostern gibt es außerdem online ökumenische Gottesdienste.
Gesammelt werden auch Rosenkränze für die Seeleute. Bei den Besuchen werden ebenso Motivkarten mit Gebeten an Bord gelassen oder die Papiertauben, die im vergangenen Jahr als Hoffnungs- und Friedenszeichen unter der Decke des Kleinen Michels hingen. „Seit dem 24. Februar hat dieses Zeichen eine ganz neue Dimension bekommen“, berichtet Lejla Semsi. Mit Sicherheit gilt dies auch für den Ukrainer, der sich über ihren Besuch freute.